Lebt von Luft und Liebe
8. Januar 2024 | Bild der Woche | 4 Kommentare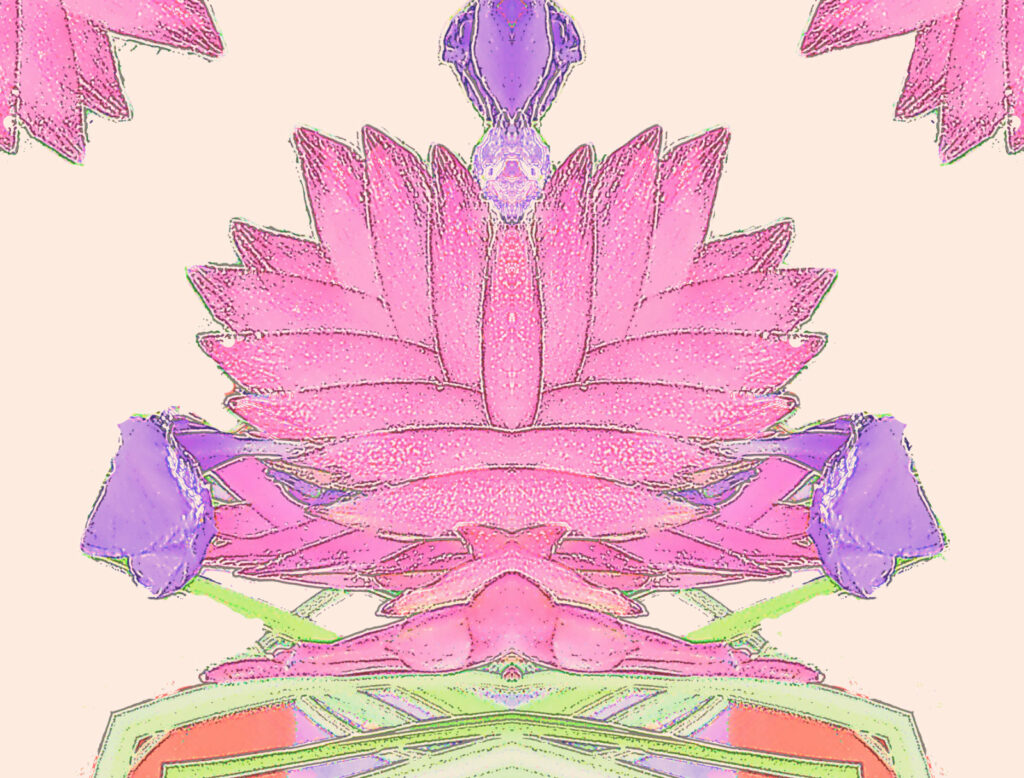
Pflanze der Woche - was stellt das Bild dar?
Sie hatten wieder herumgespielt in der Pflanzenredaktion. Verbotenerweise, denn eigentlich hatte der Chef ihnen jegliche Manipulationen an Bildern untersagt. Eigentlich. Denn zum einen war es manchmal notwendig, Bilder etwas zu abstrahieren, besonders dann, wenn es sich um solche von Pflanzen handelt, die jedes Kind kennt. Oder Von Google-Lens und anderen „KI-Programmen“ sofort erkannt und bestimmt werden. Und außerdem, das fand Elfriede, machte es einfach Spaß. Irgend ein Fotoshop-Menüpunkt aufmachen, draufklicken und schwupp. Manchmal kamen bei dieser Rumprobiererei ganz nette Muster raus. Auch wenn Heino fand, dass sie da nicht gerade systematisch vorging. Schon nach kurzer Zeit wusste nämlich niemand, welche Operationen sie da durchgeführt hatte, um das Bild beispielsweise zu drehen, spiegeln, verzerren oder sonstwas. Das war auch so bei unserem Pflanzenbild dieser Woche.
Erkennt man, was das ist? Wahrscheinlich nicht. Deshalb gibt es noch ein paar Zusatzinformationen. Paradox ist erst einmal, dass es zwei lateinische Gattungsnamen gibt, die sich grundlegend unterscheiden. Eine, die im angelsächsischen Raum eher üblich ist, und ein anderer, der offenbar im deutschsprachigen Raum häufiger verwendet wird. Der „englische“ Gattungsname geht aber nicht auf einen Landesteil in England zurück, sondern auf den Nachnamen eines im 19. Jahrhundert bekannten, deutschen Pflanzensammler. Und die in Deutschland häufiger zu findende Gattungsbezeichnung wurde schon vom alten Linné gewählt. Der hatte sich mit der Bezeichnung über einen legendären alten finnischen Botaniker lustig gemacht. Aber es gibt noch andere Gattungsnamen, die von „Baumbart“ bis zu Napoleon reichen.
Die Verwirrung reicht bis in die botanischen Gärten: Dort trifft man unsere Pflanze im Gewächshaus, und gerade jetzt im Winter blüht sie. Tatsächlich in diesen Barby-World-Farben, die sind nicht das Ergebnis einer Manipulation. Und weil sie so schön ist, findet man sie sogar auf dem Baumarkt. Dazu kommt ihr zu Gute, dass sie wenig anspruchsvoll ist. In ihrer Heimat wächst sie sowohl in der Erde als auch in der Luft. Sogar auf Bäumen, denn sie aber nicht schadet, auf Steinen und sogar Hausdächern. Auf Erde ist sie nicht unbedingt angewiesen, sie ernährt sich „aus der Luft“. Hohe Luftfeuchtigkeit und ein bißchen Sprühnebel reichen schon, dann saugt sie das Wasser mit ihren Blättern, auf oder leitet es in den Blättern, die wie Rinnen wirken, zu ihrem Fuß. An mineralischen Nährstoffen reicht ihnen das, was aus verwesenden Blättern freigesetzt wird, die gelegentlich auf sie herab fallen. Aber nochmal zu den Blüten: die sind nämlich spektakulär. Zunächst schiebt die Pflanze aus der Mitte der Rosette einen langen Schaft, der sich zu einem pinkfarbenen Paddel verbreitert, wie ein Biberschwanz. Aber das ist nicht die Blüte. Die wiederum wachsen seitlich aus dem Fächer heraus. In Knallblau.
OK, ihr wisst sicher, von was für einer Pflanze die Rede ist. Welche?
Was sind die unterschiedlichen Gattungsnamen?
Die Gattung gehört wiederum zu einer großen Familie, zu der auch viele andere Zierpflanzen, aber auch eine beliebte Frucht gehören. Welche?
Welche geometrischen Operationen führten zu dem Rätselbild?
Wer aber im Baumarkt so eine schöne Pflanze kauft, wird, obwohl die Pflanze langlebig ist, schnell enttäuscht sein. Auch bei bester Pflege geht sie ein. Warum? Falscher Standort am Fenster, zu viel, zu wenig gedüngt, oder was ist da los?
Auflösung der letzten Pflanze der Woche („Zerrupfter Patenbaum“): Quercus cerris, Zerr-Eiche
Sehr gut, Rati. Präzise gelöst: Zerr-Eiche (Quercus cerris). Man findet den Patenbaum hier: im Gimritzer Park:
https://geodienste.halle.de/baumpaten/#18/51.48716/11.95152
Und bis zum 31. M;ai dieses Jahres muss man sich bei der Stadt Halle anmelden, wenn man Baumpate werden will:
https://geodienste.halle.de/baumpaten/#12/51.4776/11.9650
- Zerr-Eiche, Quercus cerris
- Der Patenbaum im Gimritzer Park im Winder
- Stifterschild
Alle seit 2016 vergangenen Wochenpflanzen findet Ihr hier im Archiv.
Kommentar schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

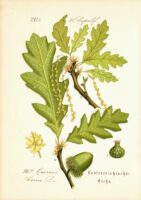



„Elias Tillandz war Professor der Medizin an der Akademie zu Turku in Finnland. Er gründete dort 1678 den Botanischen Garten und führte das Botanikstudium ein. Er publizierte 1673 unter dem Titel Catalogus plantarum die erste Flora von Finnland.“
Soweit, so richtig. Aber man kann auch etlichen Unfug lesen im Netz, so bei einem Online-Pflanzenhändler: “ Der Name stammt von der schwedischen Botanikerin Elia Tillands, die Wasser hasste, genau wie die Tillandsia“
Die Gattung Tillandsia wurde 1753 durch Carl von Linné bezeichnet. Der wissenschaftliche Gattungsname ehrt den finnischen Botaniker Elias Tillandz (1640–1693). Es wird erzählt, dass Tillandz auf einer Reise seekrank wurde und er deshalb den weiten Rückweg zu Fuß bewältigte. Linné wählte den Gattungsnamen, da er dachte, dass auch die Tillandsien kein Wasser vertragen.
Nachtrag, Bromelien blühen nur einmal und sterben dann ab, allerdings kann man eine Kindelbildung beobachten.
Gesucht wird die Tillandsia. Eingedeutscht werden sie Tillandsien genannt und sind mit über 550 Arten die artenreichste in der Familie der Bromeliengewächse. In England verwendet man zu Ehren des deutschen Botanikers Gustav Wallis den Namen Wallisia.
Tillandsien können sich – wie andere Bromelien auch – nur durch Bestäubung oder Kindelbildung vermehren.
Tillandsien nicht selbstbefruchtend.
Ich vermute, die Grafik wurde am PC gequetscht, der schwertförmige Schaft ist lang und schmal.
Eine wichtige Bromelie ist noch die Ananas.