Carl von Linné hat sich getäuscht, und die Indios konnten es sich in die Haare schmieren.
6. Dezember 2017 | Bild der Woche | 6 KommentareEs hat geschneit, ein dämmriger Sonntagnachmittag in Halle-Neustadt. Langsam verstummt der Kinderlärm zwischen den Häuserschluchten, der letzte Schneeball aus Pappschnee ist geworfen, die Grünanlagen leeren sich, zwischen tropfnassem Gestrüpp, in dem auch unsere Wochenpflanze ihr Dasein fristet, liegen schon die ersten Böllerfetzen. Die Knallerei hat schon begonnnen, abends machen die kleinen Kindern den Großen Platz – es sind die typischen Winterklänge in der in die Jahre gekommenen Neubausiedlung. Offenbar sind schon die ersten Lieferungen aus Polen eingetroffen, oder sind es die Vorräte vom letzten Jahr? In dieser nassfeuchten Winternacht mit ihrem ungemütlich orangerot leuchtendem Himmel mag man nicht mehr gerne draußen sein – da steigen wir lieber die Betonstufen hinauf, schließen uns ein, und stöbern bei einem Tee mit Rum in der guten Stube in alten Pflanzengeschichten herum. Und so begegnen wir unausweichlich dem alten Carl von Linné in seiner verlausten Perücke, gleichwohl aber dem unermüdlichen, geradezu zwanghaften Naturforscher, dem wir mit seinen beiden Werken Species Plantarum(1753) und Systema Naturæ (1758) unsere bis heute verwendete wissenschaftliche Nomenklatur der Botanik und Zoologie verdanken.
Erst er, so lesen wir, führte eine strikte Ordnung ein: Jede Pflanze erhielt einen Vornamen und Nachnamen, und zwar in der Weise „Mayers Sepp“. Erst kommt der Gattungsname, dann die Artbezeichnung. Linaeus versuchte dabei, die von ihm vermuteten Verwandtschaftsbeziehungen der Arten unterzubringen. Seitdem gilt dieses strikte binäre System, Gattungsname (gr0ß geschrieben, Artname (Art-Epitheton) klein. Also: Rosa canina, die Hundsrose. Zuvor nannte jeder Naturkundler die von ihm beschriebenen Arten so, wie er es für richtig befand, und es entstand in gewaltiges Durcheinander an Namen, die oft aus mehreren beschreibenden Einzelteilen bestanden, beispielsweise „Rosa flore rubello majore multiplicato sive pleno“ beschrieb eine Rosensorte, die irgendwie rot, groß und gefüllt war. Niemand konnte nachvollziehen, um welche Art oder welche Zuchtform es sich gehandelt haben mag.
Linne wirkte als der Enzyclopädist und Systematiker als Professor in Uppsala, und zwar von 1741 bis zu seinem Tode 1778. In die ganz weite Welt war er nie hinaus gekommen, wenn man von Aufenthalten in England, Frankreich und den Niederlanden einmal absieht. In dieser Hinsicht hatte er viel mit seinem antiken Vorbild Plinius gemein. Aber er klassifizierte Pflanzen aus aller Welt, die ihm in Form von Herbaren oder Zeichnungen von Fachkollegen aus aller Welt zugesandt wurden. So empfahl er beispielsweise der königlich schwedischen Akademie der Wissenschaften, den jungen Botaniker Pehr Kalm auf eine Reise nach Nordamerika zu senden. Dort sollte er nach neuen Nutzpflanzen zu suchen, die auch in nordeuropäischem Klima gedeihen könnten. 1748 bis 1751 dauerte Kalms Expedition, die er später in drei Bänden veröffentlichte (En Resa till Norra Amerika; die Aufzeichnungen zum vierten Band sind durch ein Feuer zertört worden) .
Aus Pennsylvania brachte Kalm dann auch unsere Wochenpflanze mit. Linne besah ihre Blüten und ordnete sie der Gattung vaccinium zu, den Blaubeeren. Heute befindet sich unsere Pflanze nicht in der Gattung vaccinium, sondern einer eigenen. Carl von Linne verfügte halt noch nicht über die Methoden, derer wir uns heute, bis hin zur Molekularbiolgie, bedienen können. Eine große Karriere als Nutzpflanze hat unsere Gewächs dann auch nicht gemacht, zumindest nicht zu Speisezwecken. Die „Beeren“ sind auch nicht einmal blau (das sind sie nur in unserer Abbildung, die Redaktion hat in dieser langen Winternacht ein bisschen viel im Grafikprogramm herumgespielt), und werden von manchen sogar als giftig angesehen. Die amerikanischen Ureinwohner sollen die Früchte zum Haarewaschen benutzt haben, das Holz verwendeten sie gelegentlich für Pfeile. Auch bei uns wächst die Pflanze mittlerweile nahezu überall: und sorgt gelegentlich für Konflikte zwischenmenschlicher Art. Einer davon hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, und stürmte sogar einmal die deutschen Hitparaden.
Unsere Fragen:
- Wie hatte Linnaeus unsere Pflanze benannt?
- Wie heißt sie heute (dt. Trivialname, wiss. Name)
- Und wie der erfolgreiche „Hit“ ?
- Wieso haben sich die „Indianer“ damit die Haare waschen können?
- Welche „Farbe“ hat die Frucht, und wie kommt sie zustande?
- Ein Kinderspielzeug ähnelt unserer Pflanze. Was ist dessen chemischer Inhaltsstoff?
- Warum leuchtete der Himmel über Halle orange?
- Wer kann Schwedisch und übersetzt die hier eingeblendeten ersten Zeilen des Tagebuchs von Pehr Kalms?
Auflösung der letzten Wochenpflanze („Rattengift gegen Liebeskummer“): Brechnus, Strychnos vomica:
Im Wahnsinn der Liebe
User Rati hatte es offenbar ganz leicht mit diesem Pflanzenrätsel: Entweder hat er Erfahrung mit Liebeskummer und/oder mit Ratten, oder aber er ist ein ausgeprägter Ratefuchs…
Jedenfalls war das alles richtig: Die Gewöhnliche Brechnuss Strychnos nux-vomica war hier abgebildet, in Form ihrer Samen. Die Brechnuss ist ein ausladender, strauchartiger Baum, der bis zu 25 m Höhe und 3 m Umfang erreicht – an seinem ursprünglichen Standort, der in Trockenwäldern Sri Lankas vermutet wird. Heimisch ist er auch in Indien und Birma. Sein deutscher Name ist u.a. Strychninbaum. Die einem 2-Cent-Stück ähnelnden Samen werden selbst einfach Brechnuss genannt, oder auch Krähenauge, sowie englisch „Quakerbuttons“, in Anlehnung an das einfache Leben der religiösen Gruppe der Quäker („Zeugnis der Einfachheit“), was sich in der typischen Kleidung der Quäker ausdrückt. Verkostet man die Samen, sollen sie bitter und scharf schmecken und Übelkeit hervorrufen – trotzdem ist der Name Nux vomica (Nuss, brechen) für die zu zweit bis viert in einer Beerenfrucht heranreifenden Samen eher irreführend. Tiere wurden damit früher vergiftet, auch der Mensch musste sich dieser Medizin aussetzen. Bis Samuel Hahnemann aktiv wurde und Nux vomica als eines der ersten Homöopathika testete. Auch heute ist dieses Mittel noch weit verbreitet. Ein Verzehr der Samen zieht die Wirkung nach sich, Sinneseindrücke zu verstärken, Farb- und Helligkeitsunterschiede breiter wahrzunehmen, das Gesichtsfeld zu vergrößern und das Tastempfinden zu verbessern. Es muss einem klar sein, dass man sich vergiftet: Die Brechnusssamen werden heute noch zur Gewinnung von Strychnin verwendet, denn dieses Alkaloid ist eines der giftigen Inhaltsstoffe, das auch als Dopingmittel und Rattengift bekannt wurde. Strychnin, dessen Strukturaufklärung sogar mit einem Nobelpreis verbunden ist, verhilft zu einer Übererregung der Rückenmarksnerven, sodass die Skelettmuskulatur tonische Kontraktionen und Spasmen ausführt. Bei Hexenschuss soll das helfen. Adolf Hitler soll über viele Jahre täglich Strychnin eingenommen haben, zur Entspannung der Darmmuskulatur. In der Fachliteratur wird beschrieben, dass als erste Vergiftungserscheinungen eine Steifheit der Gesichts- und Nackenmuskulatur auftreten, sowie Hyperreflexie. Sehen wir da einen Zusammenhang?
Die Antwort zur Frage Nr. 2 ist noch offen, auch wenn es zwei durchaus plausible Vorschläge gab, wie der fiktive Georg unserer Geschichte mittels der Brechnuss gegen seinen Liebeskummer arbeiten könnte. Die gesuchte Antwort wäre eine andere gewesen, dazu wäre aber ein weiteres Foto hilfreich gewesen: Ein Bild der Samen einer anderen Brechnuss, nämlich der Ignatius-Brechnuss, Strychnos ignatii. Sie ist eine tropische Liane, ihre Samen sind kantige, schwere „Kieselsteine“, von denen bis zu 40 in einer zitronengroßen Beere heranwachsen. Auch wenn dieser Samen, die Ignatiusbohne, dem heiligen Ignatius von Loyola gewidmet ist, der den Jesuitenorden gegründet hat, ist es ebenso eine giftige Strychnin-haltige Brechnuss. Wiederum die Homöopathie nutzt diese – und zwar in erster Linie als passende Arznei bei akutem Trennungsschmerz und Verlust. Liebeskummerpflanze!
Gehörte das nicht in jede Hausapotheke?
Fast jeder wird im Laufe seines Lebens mindestens einmal liebeskrank, muss spüren, wie weh es tut. Einmal? Ach… Und schmerzhaft: Das ist individuell unterschiedlich. Liebeskummer kann ganz harmlos nur einige Tränchen fordern, rasch verfliegen. Doch je nach Persönlichkeit, je nach emotionaler Verflechtung, kann er auch zu schweren seelische-psychosomatischen Beschwerden führen. Dann droht ein gebrochenes Herz, der Schmerz macht einen fast wahnsinnig. Es gibt, ironischer Weise, eine hübsche Geschichte, in der beschrieben wird, wie sich Liebe und Wahnsinn erkannten und warum sie also gegenseitige Begleiter sind. Zeitlich verortet wird das auf den Anfang der Erde, wobei erst der spät hinzugekommene Mensch in der Lage ist, diesen Dualismus (Liebe – Wahnsinn) auszuleben – oder zu sublimieren. Hier ist die Geschichte nachzulesen (sehr empfehlenswert!): http://www.cafe-deutsch.de/lektuere/besinnliches/die-liebe-und-der-wahnsinn.html
Die positiven Seiten des Kummers
Sublimierung, was ist damit gemeint? Berufen wir uns auf S. Freud, so meinen wir die „Fähigkeit, das ursprünglich sexuelle Ziel gegen ein anderes, nicht mehr sexuelles, aber psychisch mit ihm verwandtes, zu vertauschen“. Also, einen Ersatz suchen? Essen, Alkohol – oder Grillen und Fernsehen? Oder auch Schreiben? Das Verfassen von Artikeln, Gedichten, literarischen Werken? Jawoll!
Ein Meister dessen war Goethe – Meister der Literatur, der Liebe, des Liebeswahnsinns, des Leidens. Immer wieder waren Goethes fruchtbarste Schaffensperioden mit der Verarbeitung seiner (Liebes-)Konflikte verknüpft. In der Marienbader Elegie deutet sich jedoch an: Alles war umsonst, es klappt so nicht! Sublimierung im literarischen Schaffen tritt bei Goethe nicht an die Stelle der Liebe, sondern es verhält sich genau umgekehrt: Erst durch die (fortwährende, wenn auch verschmähte) Liebe gelingt ihm das Schreiben, nicht jenseits der Leidenschaft, sondern von ihr diktiert. Goethe findet also keinen Ausweg durch Sublimierung, sondern lebt genau darin sein Leiden aus – als seine Form von Bewältigung und Wachstum, bis hin zum Glück. Doch nicht jeder vermag so zu leben, so zu leiden wie Goethe. Dem Himmel sei Dank! Für das Durchschnittsmenschlein gilt also weiterhin: Sublimierung heilt uns von Liebeskummer, ist uns zugleich ein Antrieb für Kultur und Selbstverwirklichung. Liebeskummer lässt uns wachsen. Rational ist das gut zu verstehen. Aber wie kann nun Georg Bauer dorthin gelangen, wie gelingt ihm Wachstum? Ein Blick auf die Maslow’sche Bedürfnispyramide mag hier weiterhelfen:
Wo ist in dieser Pyramide das ubiquitäre Internet als unser absolut basales Grundbedürfnis zu finden?
Auch wenn erst einmal unsere „Defizitbedürfnisse“ erfüllt sein müssen, um zufrieden zu sein, wollen wir den Blick auf die Wachstumsmöglichkeiten richten: Wenn wir uns selbst verwirklichen, wird unser Glück weitergeführt. Erkenne Dich selbst, nutze Deine Talente! Und dann, Georg, wird Dir bewusst: Diejenige, die Dich verlässt, hat Pech gehabt, denn sie hat einen gereiften, wertvollen Partner verloren! Ooommmm.
Kommentar schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

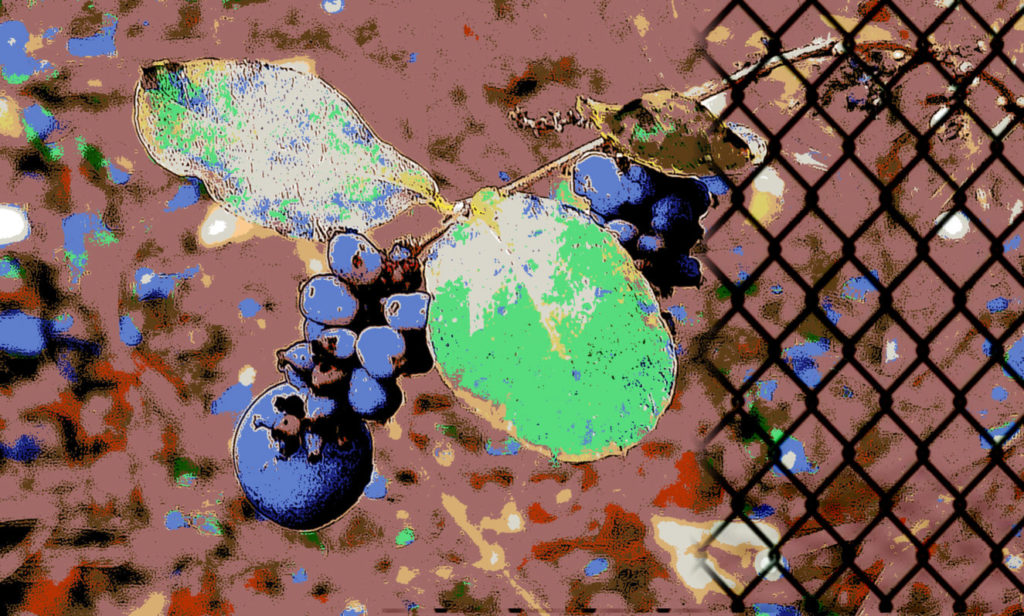

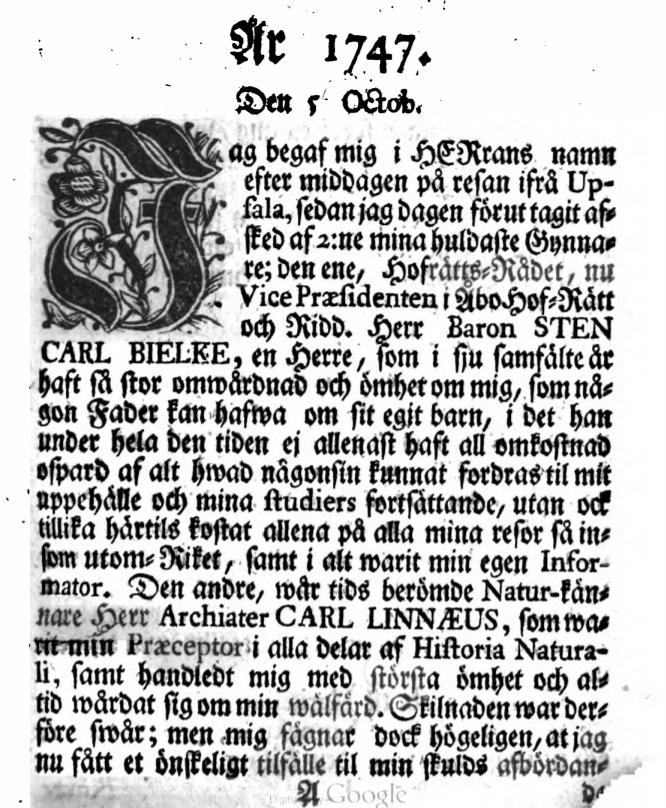



Die Schneebeere enthält Saponine – seifenähnliche Stoffe. Falls die pyrotechnischen Knallerbsen als Kinderspielzeug durchgehen (Kinder sind sicher immer begeistert) wäre der „wirksame“ Bestandteil Knallsilber.
Immerhin: 2 von 8 Fragen beantwortet. Der Rest bleibt fürs Wochenende?
Geht mir auch so 🙂
Ich gestehe, ich kann heute noch an keinen vorbeilaufen, ohne Knallerei!
Die Aufnahme ist besser:
https://www.youtube.com/watch?v=hfEmapLq0nM
Verdammt lang ist es schon wieder her…
https://www.youtube.com/watch?v=i-UP6Ayuyvg
Gnallerbsenstrauch