Beim Glühwein gehört…
31. Dezember 2017 | Bild der Woche | 5 KommentareWeihnachteten, aber an Schnee fehlte es mal wieder. Die letzten Stunden des diesjährigen Weihnachtsmarktes waren angebrochen. Georg Bauer hatte sich nach (fast zu) langem Zögern doch noch zu einem entsprechenden Bummel entschlossen. Mit einer Glühweintasse in der Hand wurde er nun „mit halbem“ Ohr Zeuge der Unterhaltung einer schon etwas angeheiterten und damit auch etwas lauten Gesellschaft. Es schien um ein Gewürz zu gehen. Mengenmäßig sei es das wichtigste – spontan tippte Georg für sich auf das Salz. Aber nun: es sei wohl belegt, dass es früher (um 1500?) in unvorstellbaren Mengen (aus heutiger Sicht) in einem Honiggebäck enthalten war. War es das wirklich, oder nannte man das Gebäck nur so? Noch früher sollen die Römer extra Speicher dafür angelegt und ihre Handelsinteressen auch militärisch gesichert haben. Vom Reich des Kaisers Augustus hörte man beim weihnachtlichen Krippenspiel immer wieder – aber bis nach Indien? Und es kam noch heftiger: als Medizin galt das „Zauberkraut“ also auch, für Tributzahlungen wurde es genutzt, bei den Römern war es aber von der Steuer befreit. Ein äußerst wirksames Insektengift sollte es auch noch sein und gegen Clostridien und Würmer helfen. Eine Stadt sollte sich auch damit von ihren Belagerern frei gekauft haben. Ein Symbol von Macht und Männlichkeit … Und was, jetzt auch noch Malariamittel? Georg fing der Kopf an zu schwirren – lag das schon am Glühwein? Inzwischen fand er es schade, dass er nicht mitbekommen hatte, wovon die Rede war. Sicher würde er es zuhause herausfinden. Wir fragen aber schon mal die Leser des Hallespektrums:
- Welches Gewürz mag es sein?
- Welche Pflanze oder welche Pflanzen könnten in Betracht gezogen werden?
- Ist das Honiggebäck auch heute noch erhältlich?
(F.H.)
Auflösung der letzten Pflanze der Woche (In der Redaktion brennt noch Licht). Beta Vulgaris, Zuckerrübe, Mangold, Rote Bete.
Im Jahre 1747 trug der Chymist Andreas Sigismund Marggraf der Königlich-preußischen Akademie der Wissenschaften seine jüngste Entdeckung vor. Marggraf ist einer jener Naturforscher, die den langsamen Übergang von Alchemie zur modernen Chemie markieren. An den Stein der Weisen glabte er nicht mehr, auch die Transmutation war für ihn in seiner Forschung kaum noch ein Thema. Allenfalls kann man ihn als einen der letzten Vertreter der Phlogiston-Theorie bezeichnen. Aber vor Allem war er als Kind der Aufklärung und so standen ergebnissoffene Forschung und Experimente im Vordergrund. Und so untersuchte er alles, was ihm unter die Finger und in die Retorten geriet. Seine umfassenden Arbeiten publizierte er erst 1769 in dem zweibändigen Werk „Chymische Schriften“, einem wahren Sammelsurium interessanter Naturbeobachtungen und Entdeckungen. So hatte er unter anderem Ameisensäure durch Destillation von Ameisen (sic!) gewonnen, Bologneser Leuchtsteine ebenso untersucht wie den damals beliebten Modestein „sächsischer Serpentin“. Marggraf hatte auch verschiedene einheimische Pflanzen auf ihre Inhaltsstoffe untersucht, und dabei bemerkt, dass viele von ihnen einen Stoff enthalten (er nannte ihn ein „Salz“), der dem ausländischen Rohrzucker genau gleicht. Einen besonders hohen Zuckergehalt fand er in der „Runkelrübe“ oder dem weißen Mangold, beides Zuchtformen von Beta vulgaris, der wilden Rübe. Marggraf hatte auch das enorme wirtschaftliche Potential seiner Entdeckung erkannt, aber offenbar keine Lust, hier selbst tätig zu werden. Das überließ er lieber seinem Freund und Lieblingsschüler Franz-Karl Achard, der die Zuckergewinnung zur Serienreife führte, und in der Folge in mehreren Pilotprojekten auf verschiedenen seiner Landgüter (die immer wieder abbrannten, was immer herbe Rückschläge bedeutete) Zucker produzierte. Der preußische Staat förderte das Projekt immer wieder mit Krediten, und offenbar mit Weitsicht: Preußen wurde vom Import des teuren, überseeischen Zuckers unabhängig . Das bewährte sich schon nach kurzer Zeit während der Kontinentalsperre, die Napoleon 1806 gegen England verhängt hatte, um so das Zucker-und Rumgeschäft der Engländer und Spanier zu blockieren. Die Rübenzuckerindustrie in Preußen konnte das nur befördern.
- Andreas Siegismund Marggraf
- Franz-Karl Achard
- Chymische Schriften, Titelseite des zweiten Bandes
- Anfang des Aufsatzes über den heimischen Zucker, S. 70 ff.
Den richtigen wirtschaftlichen Durchbruch dieses Industriezweigs, der so richtig in den 1830er Jahren Aufschwung nahm, erlebte Achard, der 1821 verarmt starb, dann nicht mehr. Da hatte er ein bewegtes Leben hinter sich, das auch durch private Beziehungsgeschichten sehr wechselvoll, und in den Augen seiner hugenottisch-Protestantischen Familienangehörigen verwerflich erschien. Die erste Ehe, die von der Familie als „Misalliance“ angesehen wurde, beendete seine Frau 1783, indem sie die Scheidung einreichte. Daraufhin ließ sich Achard mit seiner minderjährigen Stieftochter ein, mit der gerade 17-Jährigen zeugte er eine Tochter und zwei Jahre später einen Sohn. Verwandte und Freunde sahen das als Skandal an und distanzierten sich von ihm. Das hinderte ihn nicht daran, 1796 eine weitere Liason mit einer Hausangestellten einzugehen, was zu weiteren zwei Kindern führte.
Das kann man alles nachlesen, Leser Einbeck hatte ja bereits die Links zu den Wikipedia-Artikeln zur Zuckergeschichte gelegt, und damit schon einige Fragen zu unserer Pflanze beantwortet. Die Wildform ist Beta vulgaris, die wilden Rübe. Sie ist in mitteleuropäischen Küstengebieten heimisch und kommt dort heute auch noch vor. In der Regel ist sie zweijährig, das heißt, im ersten Jahr bringst sie die Blattrosette und eben die „Rübe“ hervor, im zweiten Jahr, nach erfolgreicher Überwinterung in mildem Küstenklima, den hohen, rutenförmigen Blüten- und Samenstand. Die Blüten sind grünlich und unscheinbar. Die Die Samen liegen in einer verholzten Kapselfrucht, die aus den vertrockneten Blütenhüllen entstanden sind.
- Komm doch, mit auf den Zuckerberg…
- Kreuzung Mangold mit Roter Bete
- Beta-Version: Mangold x Zuckerrübe x Rote Bete
Seit Achards ersten Zuchtversuchen sind aus Beta vulgaris bis heute Hochleistungssorten entstanden, die in den Rüben um die 20% Zucker enthalten. Doch Beta vulgaris kann mehr, als nur Zucker produzieren. Die gelben „Runkelrüben“ enthalten weniger Zucker, dafür sind sie auf Eiweißgehalt gezüchtet worden, um sie als Viehfutter einzusetzen. Genau so ist rote Bete aus Beta vulgaris entstanden, als auch das Blatt- und Stilgemüse Mangold. Und alle sind miteinander kreuzbar, woraus alle möglichen Varianten entstehen können (Riesige, rote Rüben von faseriger holziger Konsistenz, aber schmackhaften Stilen usw – der Autor dieser Zeilen hat die Hoffnung nicht aufgegeben, irgendwann auch eine rote Riesenrübe zu züchten, an der alle Teile gleich schmackhaft sind – bisher Fehlanzeige).
Dann war noch nach einem einst bedeutenden halleschen Industriezweig gefragt, der auf dem Rübenanbau und der Zuckerindustrie im Umland fußte. Die Antwort wäre gewesen: Süßwarenindustrie. Halloren, Most…
Kam keiner drauf. Sei´s drum.
Dafür hat @Elfriede eine nicht gestellte Frage beantwortet: Worauf spielte der Titel an?
IM KREML IST NOCH LICHT
Wenn du die Augen schließt, und jedes Glied
und jede Faser deines Leibes ruht –
dein Herz bleibt wach; dein Herz wird niemals müd;
und auch im tiefsten Schlafe rauscht dein Blut.
Ich schau’ aus meinem Fenster in der Nacht;
zum nahen Kreml wend ich mein Gesicht.
Die Stadt hat alle Augen zugemacht.
Und nur im Kreml drüben ist noch Licht.
Und wieder schau’ ich weit nach Mitternacht
zum Kreml hin. Es schläft die ganze Welt.
Und Licht um Licht wird drüben ausgemacht.
Ein einz’ges Fenster nur ist noch erhellt.
Spät leg’ ich meine Feder aus der Hand,
als schon die Dämmrung aus den Wolken bricht.
Ich schau’ zum Kreml. Ruhig schläft das Land.
Sein Herz blieb wach. Im Kreml ist noch Licht.
Der Verfasser, Erich Weinert, galt als bedeutender Satiriker in der Weimarer Republik. Das mag auch dieses Gedicht erklären.
Euch allen ein gutes Neues Jahr. Gefühlt 52 oder 53 neue Wochenpflanzen warten auf Euch. Habt Spaß.
(HW)
Kommentar schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

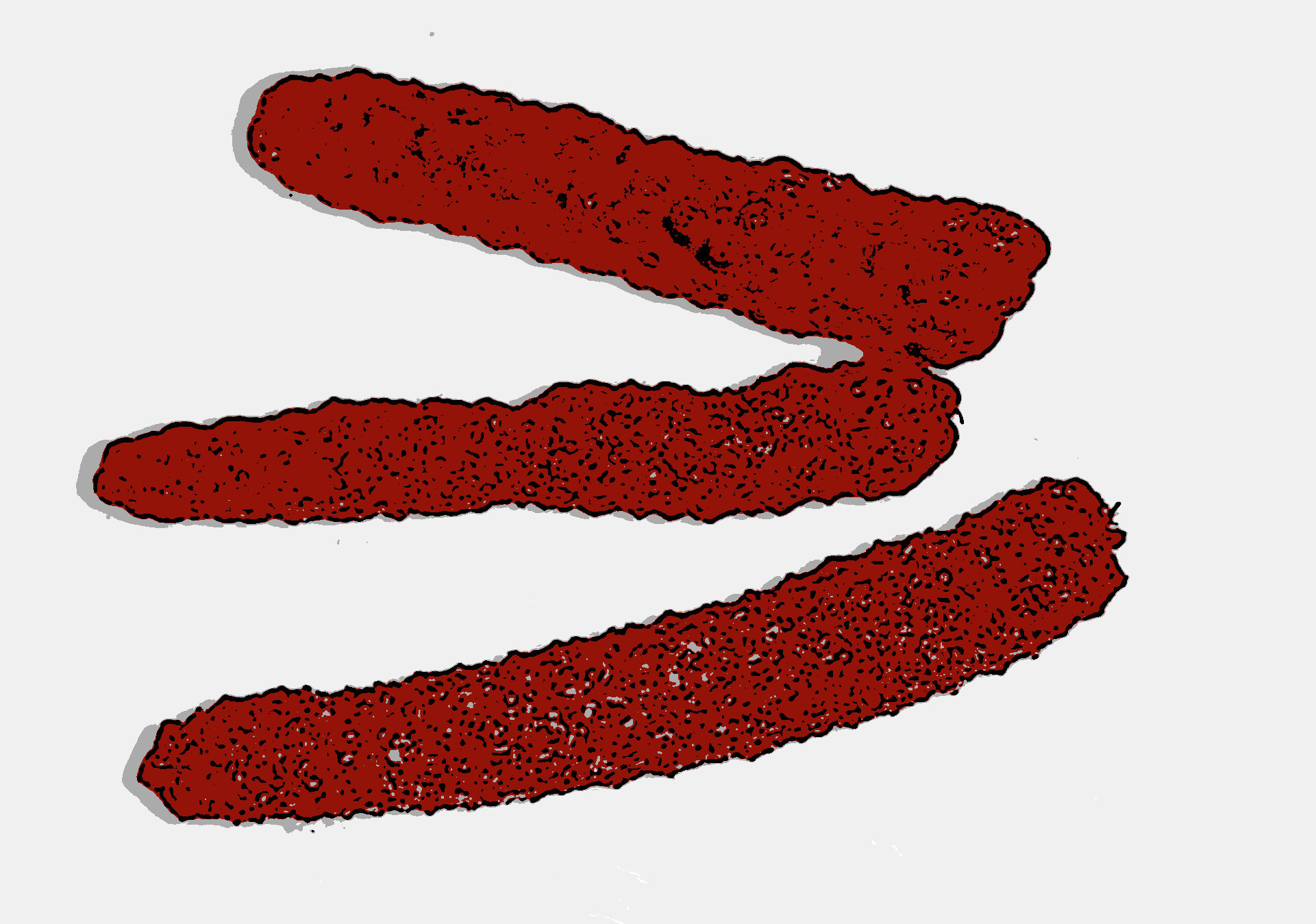




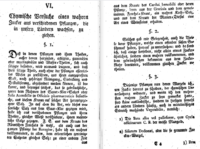





eben
“ War es das wirklich, oder nannte man das Gebäck nur so? „
In Pfefferkuchen ist kein Pfeffer drin.
Pfeffer „Pfefferkuchen“
Obwohl cacixanatl nach einem Tiroler Seitentalerdialekt klingt.
Ein bißchen erinnert das Foto an Vanille, aber das dürften die Römer nicht gewußt haben.